Gastbeitrag von Dr. Philipp Schulte
Berlin braucht mehr Wohnraum, aber keine neuen Büroflächen in Hochhäusern mitten im Gleisdreieck. Da sind sich die meisten einig. Doch entgegen aller berechtigten Kritik hat der Senat nun Anfang Juli den Bebauungsplanentwurf für die ersten zwei Bürohochhäuser im Gleisdreieckpark dem Abgeordnetenhaus zur Abstimmung und Bestätigung vorgelegt. Dieser sieht weiterhin ausschließlich gewerbliche Nutzungen vor.
Jetzt wachsen bei auch Abgeordneten in den Koalitionsfraktionen die Zweifel an dem Vorhaben und man sucht nach Auswegen. Doch statt die Planung endlich grundlegend zu überdenken und verträgliche Wohnnutzungen vorzusehen, denken manche darüber nach, die am 9.10.2025 beschlossene Neuregelung in § 246e BauGB, von der Bundesregierung als „Bauturbo“ bezeichnet, auf die Bürohochhäuser anwenden, um so darin nachträglich Wohnnutzungen zuzulassen, ohne den Bebauungsplan entsprechend zu überarbeiten.
Dieser Ansatz funktioniert allerdings gleich aus mehreren Gründen nicht.
Zuallererst kann durch § 246e BauGB der Eigentümer eines Grundstücks nicht dazu verpflichtet werden, dort Wohnraum zu schaffen. Die Vorschrift eröffnet der Baugenehmigungsbehörde lediglich die zusätzliche Möglichkeit auf Antrag auch Wohnnutzungen zuzulassen. Maßgeblich sind daher der Wille des Eigentümers und die Festsetzungen des jeweiligen Bebauungsplans. Die Rechtsprechung leitet aus der Eigentumsgarantie in Art. 14 GG die sog. Baufreiheit ab. Dieser zentrale Grundsatz des Baurechts bedeutet, dass jeder Eigentümer eines Grundstücks das Recht hat, dieses so zu nutzen und dort alles zu bauen, was und wie es planungsrechtlich zulässig ist. Was planungsrechtlich zulässig ist, bestimmt der Bebauungsplan mit seinen Festsetzungen zu Nutzungsart, Höhe, Grundfläche, Baufeldern etc . . . Für ein Vorhaben, das mit diesen Festsetzungen übereinstimmt, besteht also ein Rechtsanspruch auf Erteilung der Baugenehmigung. Diesen Anspruch kann der jeweilige Eigentümer im Streitfall auch vor dem Verwaltungsgericht durchsetzen. Wenn das Abgeordnetenhaus den Bebauungsplan VI-140cab „Urban Mitte Süd“ in der vom Senat vorgelegten Fassung beschließt, schafft dieser Bebauungsplan verbindliches Baurecht für zwei Hochhäuser mit 49 m und 25 m Höhe auf einem zweigeschossigen Sockel, der wiederum auf einer zweigeschossigen Tiefgarage stehen soll, und schreibt dort die ausschließliche Nutzung als Gewerbefläche unter Ausschluss von Wohnungen vor.
Der Eigentümer hat es mit seinem Bauantrag allein in der Hand, vorzugeben, wo und wie Nutzungsarten vorgesehen werden. Beantragt er Gewerbenutzungen und sind diese laut Bebauungsplan auf dem Grundstück rechtlich zulässig, hat er einen Anspruch auf deren Genehmigung. Die Baubehörde kann ihn nicht alternativ auf Wohnnutzungen verweisen. Erschwingliche Wohnungen entstehen so nicht. Dies geht nur durch entsprechende Festsetzungen im Bebauungsplan. Hier hilft auch die Regel gem. § 246e Abs. 2 in Verbindung mit § 36a Abs. 1 BauGB nicht weiter. Danach kann die Gemeinde ihre Zustimmung zur Anwendung des § 246e BauGB an die Schaffung von sozialverträglichem Wohnraum knüpfen. Dies funktioniert aber nur, wenn der Eigentümer ein echtes eigenes Interesse daran hat, den „Bauturbo“ in Anspruch zu nehmen, weil er das Grundstück sonst nicht in seinem Sinne nutzen könnte. Das wird hier kaum der Fall sein und so bleibt das Land am kürzeren Hebel, wenn der Bebauungsplan erst einmal umfassendes Baurecht für gewerbliche Nutzungen geschaffen hat.
Auch eine vertragliche Vereinbarung zwischen Eigentümer und Land Berlin kann einmal beschlossene Festsetzungen des Bebauungsplans nicht rechtssicher und dauerhaft zu Wohnnutzungen ändern. Denn spätestens, wenn das Eigentum wechselt, steht das Baurecht einem neuen Eigentümer zu, der an der Vereinbarung nicht beteiligt war und durch diese nicht gebunden wird. Hier sind Umgehungsmöglichkeiten von vornherein Tür und Tor geöffnet. Entscheidend für den Umfang des jeweiligen Baurechts bei einem Grundstück sind immer die Festsetzungen des Bebauungsplans, die als allgemeines Ortsrecht auch für alle künftigen Erwerber eines Grundstücks gleichermaßen gelten. Wenn man also Wohnungen in dem Gebiet ermöglichen will, muss man dies auch entsprechend planen und festsetzen. Alles andere ist nicht nur rechtlich unverbindlich, sondern auch unseriös.
In praktischer Hinsicht würde die nachträgliche Umnutzung der für Büronutzungen konzipierten Hochhäuser ebenfalls keinen Sinn machen. Denn die bislang geplante Kubatur der Hochhäuser führt zu einer immensen Gebäudetiefe. Was bei gewerblichen Nutzungen in Büroetagen durch flexible Trennwände und Glastüren funktionieren kann, ist für Wohnnutzungen mit kleineren abgeschlossenen Wohneinheiten oft nicht praktikabel. Bei innenliegenden Flächen ohne Tageslicht oder Belüftungsmöglichkeit sind gesunde Wohn- und Lebensverhältnisse, wie sie die Bauordnung für Wohnflächen fordert, nicht gesichert. Wohngebäude werden deshalb von vornherein anders geplant. Wenn man planerisch ein Hochhaus als Bürogebäude vorgibt und darin nachträglich Wohnnutzungen vorsehen will, dürfte dies vor allem zu großzügigen Penthouse-Grundrissen in den oberen Etagen führen, aber nicht zu bezahlbarem Wohnraum.
Schließlich würde der Ansatz, als Abgeordnetenhaus einen Bebauungsplan für gewerbliche Nutzungen zu beschließen, dabei jedoch insgeheim auf die Herstellung von Wohnungen zu spekulieren, den Abwägungsgrundsätzen der Bauleitplanung widersprechen. Dies macht den so beschlossenen Bebauungsplan, neben den vielen anderen Kritikpunkten, zusätzlich rechtlich angreifbar. Die Abgeordneten wüssten in diesem Fall bereits bei Verabschiedung des Plans mit gewerblichen Nutzungen, dass eigentlich etwas ganz anderes entstehen soll. Das läuft absehbar auf eine rechtsmissbräuchliche Umgehung des Gebots gerechter Abwägung hinaus, denn die jeweils abzuwägenden Belange unterscheiden sich bei Wohnnutzungen und gewerblichen Nutzungen offensichtlich.
Es hilft also nur eins: Farbe bekennen und die Planung grundlegend überarbeiten.
Dr. Philipp Schulte arbeitet als Rechtsanwalt und Fachanwalt für Verwaltungsrecht in Berlin und setzt sich dabei für eine ökologische Stadtentwicklung ein.
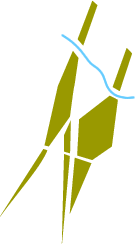
Alles richtig, aber was ist, wenn der Bauherr zur besseren Vermarktung selbst Wohnungen bauen möchte? Dass er kein Interesse an günstigen Mieten hat ist klar, aber warum keine Luxuswohnungen am Park? Die könnten sich rechnen. Und der Senat würde doch sowas genehmigen nach 246e, der tut doch alles, was den Investor zufriedenstellt und kann dann noch sagen, wieder soundsoviele Wohnungen geschaffen. Da zählt doch nur die Quantität an Wohnungen, nicht deren Miethöhe oder deren Eigentumscharakter.