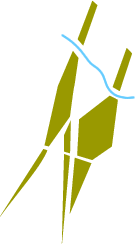Plädoyer für eine kleinteilige Stadtentwicklung – Gastbeitrag von Prof. Klaus Schäfer, der an die Sprecher*innen von CDU und SPD für Stadtentwicklung im Berliner Abgeordnetenhaus geschrieben hat.
Sehr geehrte Frau Bung / sehr geehrter Herr Schulz,
die Wahl des Projekttitels „Urbane Mitte am Gleisdreieck“ ist trügerisch. Urbanität entsteht nicht aus der Aneinanderreihung einer Vielzahl von Hochhäusern. Geradezu anstößig wirken die harmlos erscheinenden Bilder des prominenten Architekturbüros für die Veröffentlichungen der Projektgesellschaft aus Luxemburg mit dem Wissen, dass Hochhäuser eher eine antiurbane Auswirkung im Stadtgefüge aufweisen.
Zum Planungs- und Genehmigungsverfahren Gleisdreieck
Von Senatsseite werden die Inhalte der Planung so dargestellt, dass die Festlegung der Nutzung auf Gewerbe laut Baunutzungsverordnung (BauNVO) wegen des Lärms alternativlos sei. Das ist nicht richtig! Die neu geschaffene Baugebietskategorie Urbanes Gebiet (MU) lässt die Kombination von Wohnen und Arbeiten für das Gleisdreieck unter den gegebenen Umständen zu.
Erfahrungsgemäß würde, nachdem der B-Plan, wie vorgesehen, verabschiedet sein wird, die nun wertvoller gewordene Planung auf dem Investorenmarkt landen, was bedeutet, dass die Architekten ausgetauscht werden können. Man kann Investoren weder über Auflagen auf eine Ästhetik verpflichten, noch auf einen Baugrund festlegen.
Sollte zudem die Genehmigungsplanung damit gekoppelt werden, öffentliche Bereiche oder Nutzungen zu inkludieren, kann das spätestens nach der Grundsteinlegung gestrichen werden. Dafür sind zahlreiche Begründungen denkbar. Spätesten zu diesem Zeitpunkt, wenn nicht schon davor, gibt es kein Zurück in der Planung.
Alleinstellungsmerkmale
Die Singularität von Häusern als Gestaltungsmerkmal hat Auswirkungen auf die Umgebung, die erheblich vom Maßstab abhängen. Ein individueller Ausdruck verweist auf seine private Natur, eben dieser: die des Bauherrn und seiner Architekten. Die Abstandsflächen, ob als Vorgarten oder Ergebnis baurechtlicher Bestimmungen, werten diesen Charakter auf. Beim Hochhaus sorgt die alles überragende Maßstabsebene dafür, dass auch die darauf schauen müssen, die es nicht möchten. Im öffentlichen Raum der Stadt entsteht ein weithin sichtbares Zeichen. Wenn der Bauherr am Ende nicht genug Geld hat oder sein Architekt sich als talentfrei erweist, oder wenn sich einfach der Zeitgeist ändert, müssen wir immer noch darauf schauen. Der öffentliche Raum wird so beeinflusst vom persönlichen Geschmack einiger wenige.
Das Hochhaus ist eine so kostspielige Konstruktion, dass es nicht jedermann sein wird, der sich darin niederlässt. Leider bedeutet das auch, ein entsprechend monotones Klientel anzusprechen.
Öffentlicher Raum
Das Hochhaus nutzt die ihm gegebene Fläche zu 100% aus und besitzt meistens keine privaten Nebenflächen. Wenn im Gebrauch zusätzliche Bedarfe entstehen, werden sie aus der Not heraus in den öffentlichen Raum um das Gebäude verlegt oder auf die Abstandsfläche vor dem Haus.
Das Hochhaus verhält sich zu seiner Umgebung relativ autistisch bis unsozial. Appartements und Büroarbeitsplätze werden beispielsweise großzügig mit Gargenstellplätzen versorgt, sonst finden sich keine Mieter. Dumm für den, der sich einer solch tunnelartigen Ein- und Ausfahrt als Nutzer oder Passant gegenübersieht.
Sicherheitsfragen werden gleich mehrfach den Kontakt der Häuser zum öffentlichen Stadtraum dominieren. Überhaupt weiß die Wissenschaft, dass von Nutzerseite das unmittelbare Interesse am Leben auf der Straße vor dem Haus schlagartig ab dem 5. Geschoss nachlässt und sich zu einem anonymen Verhältnis wandelt. Die Nutzer begeben sich ungern in den öffentlichen Raum und umgekehrt, wird, was in den Gebäuden geschieht, nicht mehr von der Straße wahrgenommen. Es fehlt die Wechselwirkung von Distanz und Teilnahme, die aus der Urbanität durch Stadthäuser entsteht.
Haus als Maschine
Das Hochhaus gehört zu den technisch komplexen Gebäudegruppen, die mehr einer Maschine mit zahlreichen Abhängigkeiten gleichkommen, denn einem schlichten Gebäude. – Eine Havarie führt hierbei möglicherweise zu einer Kettenreaktion, gleich einem Systemfehler. Ein System, das von seiner Konzeption her unterscheiden muss zwischen Oberfläche und Untergrund, im Funktionsablauf zwischen Leben und Technik, sodass im Leben nicht ein Zuviel der Technik erscheint und in der Technik das Leben am besten ausgesperrt bleibt.
Nachhaltigkeit durch Verdichtung
Eine bauliche Dichte kann in der Stadt auf sehr unterschiedliche Weise erzielt werden und eine hohe Dichte erfordert gute Architektur. Bei Hochhäusern hebt sich der Flächengewinn durch die benötigten Abstände wieder auf. Ein finsterer Hinterhof ist heutzutage nicht das Ergebnis kapitalistischen Gewinnstrebens, sondern schlechter Architektur. Eine wissenschaftliche Untersuchung von 2017 zum Paris und seiner Planung durch Haussmann ergab, dass die für uns typische Architektur dieser Stadt, aus heutiger Sicht, bei höchster Akzeptanz seitens der Bewohner, weltweit die höchste Dichte in Kombination mit den kürzesten Wegen, bei größter Umbaufähigkeit, Energie-Ausnutzung etc. besitzt. Nach Venedig wird in keiner Stadt – gerne – so viel zu Fuß unternommen wie in Paris.
Das Hochhaus ist nachweislich für seine Bewohner ungesund, und zwar umgekehrt zur Höhe. Die bildhafte Hierarchie von Oben und Unten wirkt sich in ihrer Symbolik auf das Wohlbefinden der Nutzer aus. Zum Trost weiß die Wissenschaft, dass die Mortalität bei Herzinfarkten wegen der Länge der Rettungswege von unten nach oben zunimmt. Ab dem 16 Stockwerk gibt es statistisch kaum noch eine Chance auf Hilfe.
Zum Beispiel
Am Joachimsthaler Platz in Kudamm-Nähe lässt sich mit dem Blick in Richtung Gedächtniskirche die Tragweite der Entscheidung für ein jüngeres Hochhaus in unserer Stadt abwägen. Die Nachbarschaft des Häuserblocks wird vom „Hotel Motel One Berlin-Upper West“ überragt und geradezu erschlagen.
Stadt aus der Fußgängerperspektive im Rhythmus von Haustechnik – Garageneinfahrten, Anlieferung, Mülllager, Lüftung- und Klimaanlagen, hin und wieder eine Eingangshalle für Menschen – lässt sich im neuen Stadtteil um die Uber-Arena gut studieren. Dies bei einer Anzahl von zumeist – nur – acht Vollgeschossen.
Fazit
Es gibt keine innere Notwendigkeit, morgen die Stadt in einem einzigen Haus neu zu erschaffen, so faszinierend das auch klingen mag. Zeitgemäß ist Architektur und Städtebau, der die Stadtgesellschaft in ihrem Zusammensein unterstützt. Darin liegt ein Auftrag, der den Sinn und die Ausrichtung auf einen gesellschaftlichen Fortschritt beinhaltet. Nicht der, die Gesellschaft – gleich einer Momentaufnahme – lediglich abzubilden. Worum es mir geht, ist ein Plädoyer für eine kleinteilige Stadtentwicklung. Bauen gehört so oder so zur wirtschaftlichen Entwicklung des Ganzen, die Form ist eine politische Entscheidung.
Hiermit bitte ich Sie, der Hochhausplanung nicht zuzustimmen. Gerne können Sie sich mit mir, bei weiteren Fragen, in Verbindung setzen, worüber ich mich sehr freuen würde!
Mit freundlichen Grüßen
Prof. Klaus Schäfer
Architektur und Städtebau
www.schaefer-berlin.com
Lehrgebiet Städtebau und Entwerfen
Hochschule Bremen
Institut der Stadtbaukunst
Hochschule Bremen – School of Architecture Bremen